Arbeitspapiere
Kürzere Analysen zu verschiedenen Aspekten der Hochschulinternationalisierung und der internationalen akademischen Mobilität werden als „DAAD Arbeitspapiere“ veröffentlicht. Die Publikationsreihe richtet sich in erster Linie an Hochschulpraxis und Hochschulpolitik.
Überblick: Bisherige Publikationen
Ausblickstudie zum Programm HAW.International (November 2023)
Academic exchange between Jordan and Germany - Individual mobility, institutional cooperation, and examples of good practice (Februar 2023)
Digitale Internationalisierung an deutschen Hochschulen - Stand und (internationale) Perspektiven (Juli 2022)
Internationale Hochschulrankings - Hintergründe, Methodik und die Platzierungen der deutschen Hochschulen (März 2022)
Corona und die Folgen für die internationale Studierendenmobilität in Deutschland (März 2021)
Digitale Lehre im Zuge der Corona Pandemie (Februar 2021)
Ältere Arbeitspapiere (2019/2020)
Blickpunkte (2014-2019)
Ausblickstudie zum Programm HAW.International
Zusammenfassung:
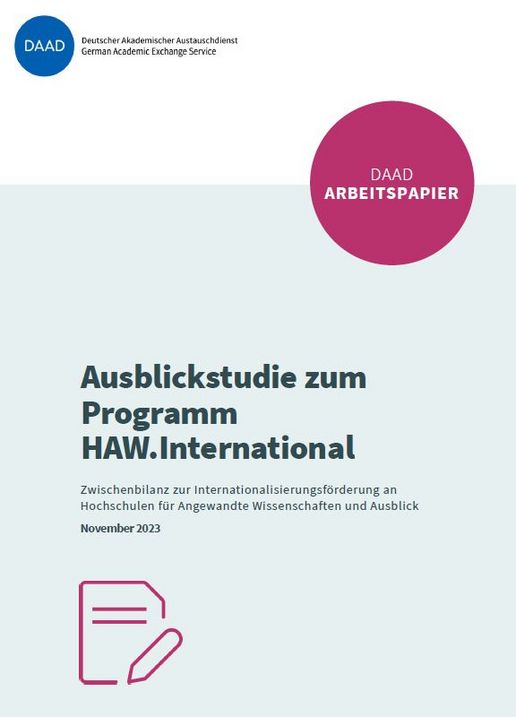
Mit dem Programm HAW.International fördert der DAAD mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) seit dem Jahr 2019 die Internationalisierung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). Zur Planung einer potenziellen zweiten Programmgeneration wurde im Jahr 2023 eine Ausblickstudie durchgeführt. Ziel der Studie war es, die bisher durch das Programm erreichten Outcomes (kurz- und mittelfristigen Wirkungen) in ausgewählten Bereichen datenbasiert darzustellen sowie weitere Informationen zu Stand, Herausforderungen, erwarteten Entwicklungen und zukünftigen Unterstützungsbedarfen der Internationalisierung an HAW zu gewinnen. Zu diesem Zweck wurden eine Analyse vorliegender Datenbestände aus dem wirkungsorientierten Monitoring des DAAD vorgenommen und qualitative Befragungen verschiedener Akteursgruppen an geförderten Hochschulen sowie von Expertinnen und Experten durchgeführt. Der Betrachtungszeitraum der Studie umfasst die ersten drei Förderjahre von 2019 bis Ende des Jahres 2022. Folgende Ergebnisse sind hervorzuheben:
Durch HAW. International werden (Incoming- und Outgoing-)Studierende an HAW gezielt im Erwerb interkultureller, fremdsprachlicher, praktischer und fachlicher Kompetenzen unterstützt: Über die Individualstipendien und die über die Projektförderung an den Hochschulen verfügbaren Mobilitätsmittel wurde die internationale Mobilität von insgesamt 6.685 Personen gefördert, davon 1.741 über die Individualstipendien und 4.944 über die Projektförderung. Der deutliche Schwerpunkt der Mobilitätsförderungen lag mit rund 80 Prozent auf Studierenden (und Promovierenden). Trotz der Umsetzungsschwierigkeiten während der Coronapandemie ist es durch das Förderprogramm gelungen, eine hohe Anzahl von Mobilitätsförderungen zu realisieren, wobei ein Teil der Mobilitäten (insbesondere im Jahr 2021) teilweise oder vollständig online realisiert wurde. Auswertungen der DAAD-Stipendiatenbefragungen weisen darauf hin, dass die über die Individualstipendien geförderten Studierenden durch die internationale Mobilität an interkulturellen, fremdsprachlichen und fachlichen Kompetenzen hinzugewonnen haben.
Über die Projektförderung wurden in Summe 622 Vorbereitungs- und Betreuungsangebote an HAW implementiert, mit denen fast 19.000 Studierende aus dem In- und Ausland erreicht wurden. Beispiele für diese Art von Maßnahmen sind Angebote, die den Studieneinstieg und die Integration an der Hochschule in Deutschland erleichtern, und Angebote, die Outgoing-Studierende auf einen Studien- oder Praktikumsaufenthalt im Ausland vorbereiten.
Merkmale und Bedingungsfaktoren von Auslandsaufenthalten im Lehramtsstudium - Auswertung der Lehramtsdaten aus dem Projekt "Benchmark internationale Hochschulen" (BintHo)
Zusammenfassung:

Im Rahmen des DAAD-Programms „Lehramt.International“ wurden die Daten der Lehramtsstudierenden aus Deutschland des DAAD-Projekts „Benchmark Internationale Hochschule“ (BintHo) gesondert ausgewertet. In der Befragung 2020/2021 äußerten sich über 10.000 Lehramtsstudierende u. a. zu ihren Mobilitätsneigungen, Motiven, Erträgen und Problemen in Verbindung mit einem studienbezogenen Auslandsaufenthalt.
In der vorliegenden Analyse werden die Daten der Lehramtsstudierenden mit denen der anderen Universitätsstudierenden aus Deutschland verglichen. Die Ergebnisse der lehramtsspezifischen Datenanalyse zeigen, dass es bei vielen Themen einen Unterschied zwischen Lehramtsstudierenden und Universitätsstudierenden mit einem anderen Abschlussziel gibt. Das macht eine zielgruppenspezifische Unterstützung durch Programme wie Lehramt.International unabdingbar.
Außerdem macht die Analyse deutlich, dass die niedrige Mobilitätsquote der Lehramtsstudierenden in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren variiert und eine Vielzahl von Ursachen hat. Diese Mobilitätshürden müssen durch Maßnahmen und Angebote auf individueller, institutioneller und struktureller Ebene abgebaut werden.
English version: Students’ stays abroad during teaching degrees: their distinctive features and influencing factors
Academic exchange between Jordan and Germany - Individual mobility, institutional cooperation, and examples of good practice
Zusammenfassung:

This working paper is meant to provide an overview of the academic exchange between Jordan and Germany. It addresses faculty, managers, decision makers, and advanced students from universities in Jordan, as well as representatives from education and science policy and from other actors involved in the field of higher education.
In the past decades, Jordan and Germany have been connected through a longstanding and reliable partnership in a variety of fields, both in higher education and beyond. The number of students from Jordan studying in Germany has been comparatively high since the 1970s, with a particular increase in the past ten years and a clear disciplinary focus on engineering, law, economics, and social sciences. Mobility in the other direction, however, is still limited, both for students and researchers. This is also reflected in the number of DAAD scholarship holders.
Compared to other countries in the MENA region, both the number of university cooperation agreements and of bi- or multilateral research projects between Jordan and Germany is one of the highest. From 2019 to 2022 alone, the DAAD has funded 66 projects between German and Jordanian partners, in addition to a variety of EU-sponsored programs such as Erasmus+ and PRIMA. With the German Jordanian University, the German Protestant Institute of Archaeology, and the recently established German Energy Academy in Jordan, this partnership also has a solid institutional background. To makesuch cooperation more tangible, five projects between Jordanian and German HEIs will be presented briefly. To conclude, some recommendations and perspectives for the academic exchange between the two countries will be discussed.
Digitale Internationalisierung an deutschen Hochschulen - Stand und (internationale) Perspektiven

Zusammenfassung:
Welche Potenziale bietet die Digitalisierung, besonders für den Bereich der international ausgerichteten Hochschullehre? Dieses DAAD Arbeitspapier fasst interessante Einsichten und Ergebnisse aus Studien und Publikationen zu den Querschnittsthemen Digitalisierung und Internationalisierung zusammen. Der Überblick bietet eine gute Basis für die nächsten Schritte der digitalen Internationalisierung und gliedert sich in die folgenden drei Ebenen:
Auf Ebene der nationalen Bildungspolitik zeigt sich, dass in den letzten Jahren vermehrt Projektförderungen an Hochschulen zu Weiterentwicklungen im Bereich der Digitalisierung geführt haben. Digitale Formate unterstützen Hochschulen dabei, Internationalisierung stärker in ihrem gesellschaftlichen Kontext umzusetzen.
Auf Ebene der Hochschulen wurden in den vergangenen Jahren zunehmend Digitalisierungsstrategien mit dem Ziel aufgesetzt, die Qualität der Lehre zu verbessern und Flexibilität zu ermöglichen. Zur Unterstützung ihrer Internationalisierung setzen Hochschulen digitale Technologien bislang jedoch nur begrenzt ein, sodass sich hier zukünftig Fragen nach Schwerpunkten in der individuellen Profilierung stellen.
Die Ebene des Lehrens und Lernens ist aktuell gekennzeichnet durch die dynamische Situation der Covid-19-Pandemie, die Onlinelehre und internationalen Virtual Exchange stark beförderte. Hier zeigt sich, dass die Potenziale der Bildungstechnologien noch nicht ausgeschöpft werden und seltener auf etablierte technische Infrastruktur zurückgegriffen wird. Für die digitalen und interkulturellen Kompetenzen der Studierenden hingegen zeigen sich positive Ergebnisse durch den virtuellen Austausch.
Download: Digitale Internationalisierung an deutschen Hochschulen - Stand und (internationale) Perspektiven
Internationale Hochschulrankings: Hintergründe, Methodik und die Platzierungen der deutschen Hochschulen

Zusammenfassung:
Internationale Hochschulrankings sind aus der Hochschulwelt nicht mehr wegzudenken. Ungeachtet ihrer beschränkten inhaltlichen Aussagekraft und ihrer methodischen Mängel sind Rankings eine gern genutzte Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Wahl einer Hochschule. Zu den Rankings, die weltweit die größte Aufmerksamkeit auf sich lenken, zählen das “Academic Ranking of World Universities” (ARWU), besser bekannt als “Shanghai-Ranking”, das Ranking von Times Higher Education (THE) und das Ranking des britischen Unternehmens Quaquarelli Symonds (QS).
Die einflussreichen Ranglisten werden traditionell und unangefochten von angloamerikanischen prestigeträchtigen Forschungsuniversitäten wie Stanford, Harvard, Oxford etc. angeführt. Hochschulen mit anderen Ausrichtungen und Schwerpunktsetzungen – wie z.B. Fachhochschulen/HAW oder kleinere spezialisierte Hochschulen (etwa Kunst- und Musikhochschulen) – werden nicht berücksichtigt oder haben kaum eine Chance, an prominenter Stelle gelistet zu werden. Die deutschen Hochschulen sind zahlenmäßig gut in den einflussreichen Rankings vertreten, rangieren aber überwiegend im mittleren Segment. Nur wenige Hochschulen erzielen Rangplätze, die eine gewisse internationale Sichtbarkeit garantieren.
Der DAAD wertet die Rankingausgaben der “Big Three” – ARWU, THE und QS – regelmäßig aus und stellt die Ergebnisse in einem Arbeitspapier vor. Das Papier geht zudem der Frage nach, wieso die Leistungsstärke des deutschen Hochschulsystems in den einflussreichen Rankings nicht adäquat abgebildet wird. Hierzu werden die Indikatoren und die Methodik der Rankings näher in den Blick genommen und die Rankings einer Bewertung unterzogen.
Prioritäten, Entwicklungsfelder und Maßnahmen zur Internationalisierung der Lehramtsausbildung: Kernergebnisse einer Umfrage an europäischen Hochschulen

Zusammenfassung:
Im Rahmen des DAAD-Programms „Lehramt.International“ wurde im ersten Quartal 2020 eine Befragung durchgeführt, um die Prioritäten, Angebote und Entwicklungsbedarfe zu erfassen, die europäische Hochschulakteurinnen und -akteure für die Internationalisierung der Lehramtsausbildung wahrnehmen. Insgesamt nahmen 407 Hochschulvertreterinnen und -vertreter mit Lehramtsbezug aus 28 Ländern teil, hiervon 89 aus deutschen Hochschulen. Die vorliegende Analyse nimmt die deutsche Perspektive in den Blick und vergleicht diese mit länderübergreifenden, europäischen Ergebnissen. Sie zeigt unter anderem:
Sowohl in Deutschland als auch in Europa sind die befragten Hochschulakteurinnen und -akteure deutlich davon überzeugt, dass die Internationalisierung der Lehramtsausbildung von hoher gesellschaftlicher Bedeutung ist.
Der Ausweitung der Studierendenmobilität wird die höchste Priorität zugeschrieben, um die Lehramtsausbildung langfristig zu internationalisieren. Maßnahmen, die zur Internationalisierung zuhause beitragen, fallen hingegen in das untere Drittel der Prioritäten.
Im europäischen Vergleich berichten die deutschen Befragten besonders häufig, dass ihre Hochschule interkulturelle Lerngelegenheiten zuhause oder im Ausland anbieten. Diese sind sowohl in Deutschland als auch in Europa schwerpunktmäßig mit Auslandsmobilität verbunden. Angebote zur Internationalisierung zuhause werden deutlich seltener berichtet.
Nachhaltige Wirkungen der DAAD-Förderung sicherstellen: Anforderungen, Dimensionen und Erfolgsfaktoren

Zusammenfassung:
Die Frage, inwieweit die Ergebnisse und Wirkungen unserer Förderungen dauerhaft Bestand haben und wie wir „Nachhaltigkeit“ in diesem Sinne erfolgreich unterstützen können, ist für den DAAD von zentraler Bedeutung. Gemeinsam mit Geldgebern, Hochschulen und internationalen Partnern richtet der DAAD seine Förderangebote (immer wieder neu) darauf aus, dass sie den Bedarf der Zielgruppen im Blick haben und nachhaltig wirken. Drei Phasen der Programmgestaltung stehen dabei im Fokus: die Konzeption und Planung, die konkrete Umsetzung und die Evaluation sowie die Weiterentwicklung von Programmen.
Mit dem vorliegenden Papier wollen wir die Maxime nachhaltiger Wirkungen in ihrer konkreten Bedeutung für den DAAD noch besser ausleuchten und für den Kontext der Hochschul- und Wissenschaftskooperation operationalisieren. In diesem Sinne ist das Papier sowohl als Positionsbestimmung wie auch als Orientierung gedacht, um die Nachhaltigkeit der DAAD-Förderungen zu bewerten und weiter zu steigern.
Ausgehend von einer Begriffsbestimmung werden zunächst spezifische Herausforderungen in den Blick genommen, die sich aus der Rolle des DAAD als Mittlerorganisation ergeben. Im Anschluss identifizieren und beleuchten wir unterschiedliche Dimensionen von Nachhaltigkeit in der internationalen Studierenden- und Wissenschaftlermobilität sowie in der Hochschulkooperation (institutionelle, individuelle, strukturelle, finanzielle etc.). Darauf aufbauend werden dann in einem letzten Schritt (Arbeits-)Hypothesen formuliert, wie bzw. unter welchen Bedingungen die Nachhaltigkeit von DAAD-Förderungen weiter gesteigert werden kann.
Corona und die Folgen für die internationale Studierendenmobilität in Deutschland: Ergebneisse der zweiten DAAD-Befragung von International Offices und Akademischen Auslandsämtern im Wintersemester 2020/21

Zusammenfassung:
Die COVID-19-Pandemie hat zu massiven Einschnitten im Alltag der deutschen Hochschulen und ihrer Internationalisierungsaktivitäten geführt. Durch die vorübergehende Schließung fast sämtlicher Präsenzangebote an den Hochschulen im Sommersemester 2020 und die internationalen Reisebeschränkungen ist insbesondere die internationale Studierendenmobilität in Deutschland stark von diesen Auswirkungen betroffen. Der DAAD hat deshalb zwischen Ende April und Mitte Mai 2020 eine Befragung unter den International Offices und Akademischen Auslandsämtern deutscher Hochschulen durchgeführt, deren Ergebnisse im Juni 2020 veröffentlicht wurden. Die Befragung erfasste die Eindrücke und Erfahrungen der befragten Hochschulmitarbeitenden kurz nach Beginn des verschobenen Sommersemesterstarts.
Um die Erfahrungen mit diesem zweiten Corona-Semester und seinen Auswirkungen auf die Internationalisierungsbemühungen der Hochschulen messen zu können, hat der DAAD in der zweiten Februarhälfte 2021 erneut eine Befragung unter den International Offices und Akademischen Auslandsämtern deutscher Hochschulen durchgeführt. Ein großer Teil der Fragen wurde hierbei aus der ersten Befragung im Sommersemester übernommen, um die Entwicklung bezüglich dieser Aspekte untersuchen zu können. Darüber hinaus wurden einige neue Fragen hinzugenommen, insbesondere zum Themenbereich „Digitalisierung und virtuelle Kooperation“.
Das vorliegende Arbeitspapier befasst sich – wie schon das Arbeitspapier zur Vorgänger-Befragung – zum einen mit den allgemeinen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Lehrbetrieb der deutschen Hochschulen im Wintersemester 2020/21 und den vermuteten Auswirkungen auf die beiden kommenden Semester, sowie den damit verbundenen Herausforderungen für das Hochschulpersonal. Der Fokus der Analyse liegt dabei jedoch erneut auf den Auswirkungen für die internationale Studierendenmobilität in Deutschland.
Download (DE): Corona und die Folgen für die internationale Studierendenmobilität in Deutschland (mit separatem Tabellen-Anhang)
Download (EN): COVID-19 and the impact on international student mobility in Germany
Digitale Lehre im Zuge der Corona-Pandemie: Ergebnisse einer Umfrage bei Dozentinnen und Dozenten geförderter DAAD-Projekte
Zusammenfassung:
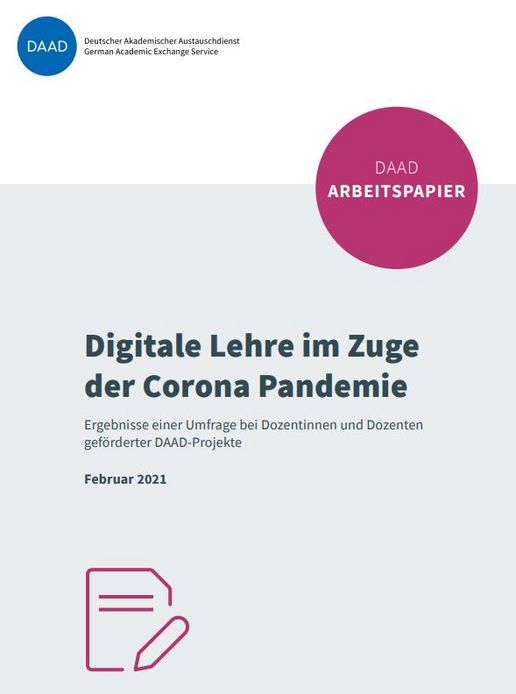
Der DAAD fördert jährlich mehrere tausend Kooperationsprojekte zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen. Im Rahmen dieser Projekte unterstützt der DAAD auf vielfältige Weise die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung international ausgerichteter Lehr- und Studienangebote.
Mit der zunehmenden Ausbreitung von COVID-19 und den damit verbundenen weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung hat sich im Laufe des Jahres 2020 die Situation an den Hochschulen, insbesondere im Bereich der Lehre, schlagartig verändert. So standen vor allem im Frühjahr und Sommer 2020 Hochschullehrerinnen und -lehrer auf der ganzen Welt vor der Herausforderung, ihre Präsenzveranstaltungen innerhalb kürzester Zeit auf virtuelle Formate umzustellen. Um mehr über die Situation der Lehrenden zu erfahren, hat der DAAD einen Fragebogen entwickelt, der die coronabedingte Umstellung auf digitale Lehre in der internationalen Zusammenarbeit1 thematisiert. Im Folgenden erläutern wir kurz unsere Methodik und fassen ausgewählte Ergebnisse der Umfrage strukturiert nach Themen schriftlich zusammen. Alle Fragen und Antworten und deren statistische Aufbereitung können dem Anhang entnommen werden.
November 2020 (nur in Englisch)
27 Variations of IHES - DAAD Programmes Under Scrutiny
Juni 2020
Februar 2020 (nur in Englisch)
November 2019
Januar 2019
Academic success and dropout among international students in Germany and other major host countries
August 2018
Oktober 2017
April 2017
Hochschul- und Wissenschaftsreform in Russland: Der lange Abschied vom sowjetischen System
April 2017
Gravierende Folgen: Was bedeutet der Brexit für die Hochschulzusammenarbeit? Ein Klärungsversuch
Juni 2016
Juni 2016
Schusswaffen an Hochschulen in den USA
Juni 2016
Die Bedeutung von Diversity im Hochschulwesen der USA: Studierende der ersten Generation
November 2015
Duales Studium als Exportmodell
Oktober 2015
Verbleib ausländischer Studierender und Absolventen in Deutschland
Juni 2014